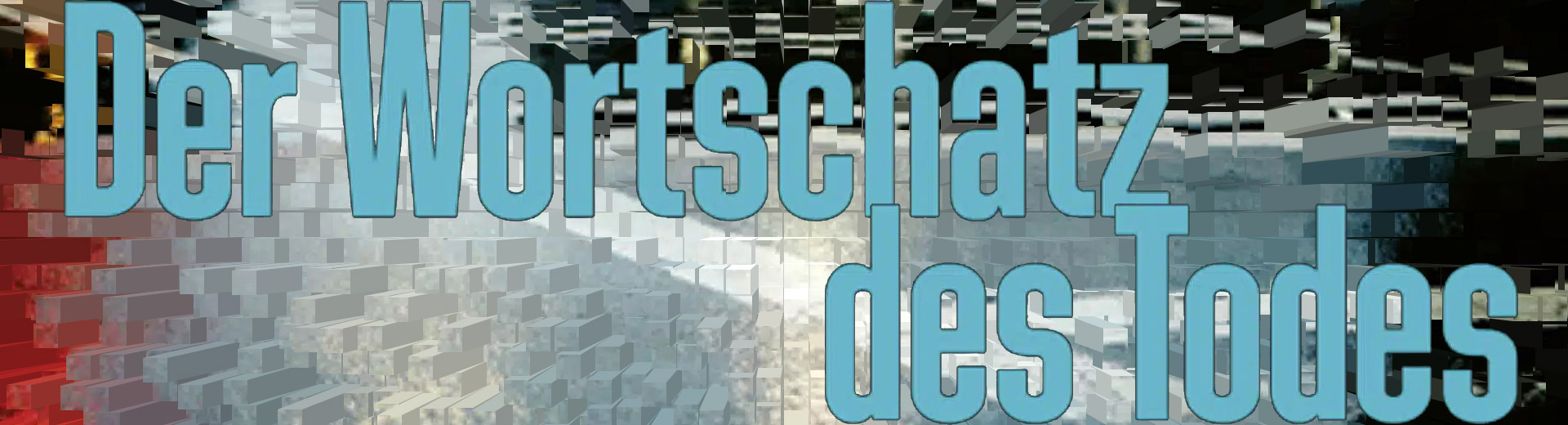FAQ zum Buch Der Wortschatz des Todes von Martin von Arndt. – Sie haben JavaScript in Ihrem Browser deaktiviert. Um den Inhalt der Seite korrekt anzeigen zu können, brauchen Sie aber ein aktiviertes JavaScript. Wenn Sie nicht wissen, wie dies funktioniert, folgen Sie bitte der Anleitung unter diesem Link.
Der Wortschatz des Todes
Was hat Sie zu Der Wortschatz des Todes inspiriert, ein Politthriller, der den Krieg in der Ukraine zum Hintergrund hat – und warum gerade jetzt?
Das Thema Osteuropa ist in meiner Arbeit schon lange im Fokus, spätestens seit meinem in Belarus spielenden Roman Oktoberplatz. Als Putin im Februar 2022 den Krieg in der Ukraine begann, wusste ich, dass ich etwas dazu schreiben musste, es hat allerdings ein paar Monate gedauert, bis ich mein eigentliches Sujet gefunden hatte. Ich denke, etwas abgedroschen könnte man sagen: Wann, wenn nicht jetzt?! Die Anti-Putin-Koalition wird von Tag zu Tag brüchiger, der russische Angriffskrieg droht aus den Medien zu verschwinden, und in Deutschland gibt es immer aggressivere Debatten über den Status der Geflüchteten aus der Ukraine. Jetzt ist die richtige Zeit für diesen Roman.
Irina Starilenko, die Protagonistin Ihres neuen Romans, ist eine starke Figur mit dunkler Vergangenheit. Wie ist sie Ihnen „zugeflogen“?
Ich bin „meiner“ Irina in Minsk 2008 begegnet, als ich für meinen Roman Oktoberplatz in Belarus recherchiert habe. Irina trägt viele Züge dieser faszinierenden belarusischen Oppositionellen, und mir war schnell klar, dass ich sie irgendwann einmal in einer Geschichte porträtieren wollte. Irina Starilenko taucht zum ersten Mal in einem Kurzkrimi auf, den ich für eine Anthologie von Ars Vivendi geschrieben habe (Tatort Fränkisches Seenland). Damals war sie noch als BKA-Fallanalytikerin unterwegs, um eine Mordserie aufzuklären. Mittlerweile hat sie das BKA hinter sich gelassen und schlägt sich auf eigene Faust durch – was mir eine viel bessere Gelegenheit bietet, sie in Aktion zu zeigen.
Was war die größte Herausforderung beim Schreiben dieses Politkrimis?
Zuerst einmal die Recherchesituation. Die Meldungen aus der Ukraine sind ja kaum unabhängig zu überprüfen, und man muss schon sehr aufpassen, nicht Kriegspropaganda auf den Leim zu gehen. Und dann natürlich der Umstand, dass Irina intergeschlechtlich ist. Mir war es ausgesprochen wichtig, Interviews mit möglichst vielen intergeschlechtlichen Menschen zu führen, um Fehler und Klischees zu vermeiden. Und um mich wirklich hineinfühlen zu können in die Person Irina Starilenko, in ihre Lebenssituation und ihre Kämpfe mit einer Gesellschaft, die ihr das Leben als Inter* nicht gerade leicht macht.
Warum war es Ihnen wichtig, eine ukrainische Perspektive in den Roman einzubauen?
Meiner Ansicht nach geht es nicht ohne. In Deutschland leben zurzeit viele Geflüchtete aus der Ukraine, die Ungeheures erlebt haben. Ich finde, dass ich keinen Roman zu diesem Thema schreiben kann, ohne die eine oder andere Erfahrung dieser Menschen zu erzählen. Durch meine ehrenamtliche Arbeit in der Geflüchtetenhilfe hatte ich das Glück, viele bewegende Begegnungen zu haben, und ich wollte einen kleinen Teil von ihnen in den Roman einbringen.
Wie viel Realität steckt hinter dem fiktiven Mordfall, den Sie schildern?
Leider sehr viel. Russlands Arm reicht weit nach Europa hinein, das haben wir durch die Morde an Selimchan Changoschwili im Berliner Tiergarten und an Alexander Litwinenko in London gesehen. Sie waren letztlich auch die „Inspiration“, wenn man das so sagen kann, ohne dass es zynisch klingt, für die politische Geschichte hinter Der Wortschatz des Todes.
Wird Irina Starilenko noch weitere Fälle lösen?
Das hängt natürlich immer davon ab, ob das Publikum Irina Starilenko ebenso liebgewinnen wird, wie ich das getan habe. Aber wenn es nach mir geht, wird sich Irina noch durch so manchen Fall hindurch schnoddern müssen, zusammen mit ihrem eigensinnigen Bruder Kostja und ihrer Nichte Xenia, einer fünfzehnjährigen Hacktivistin.