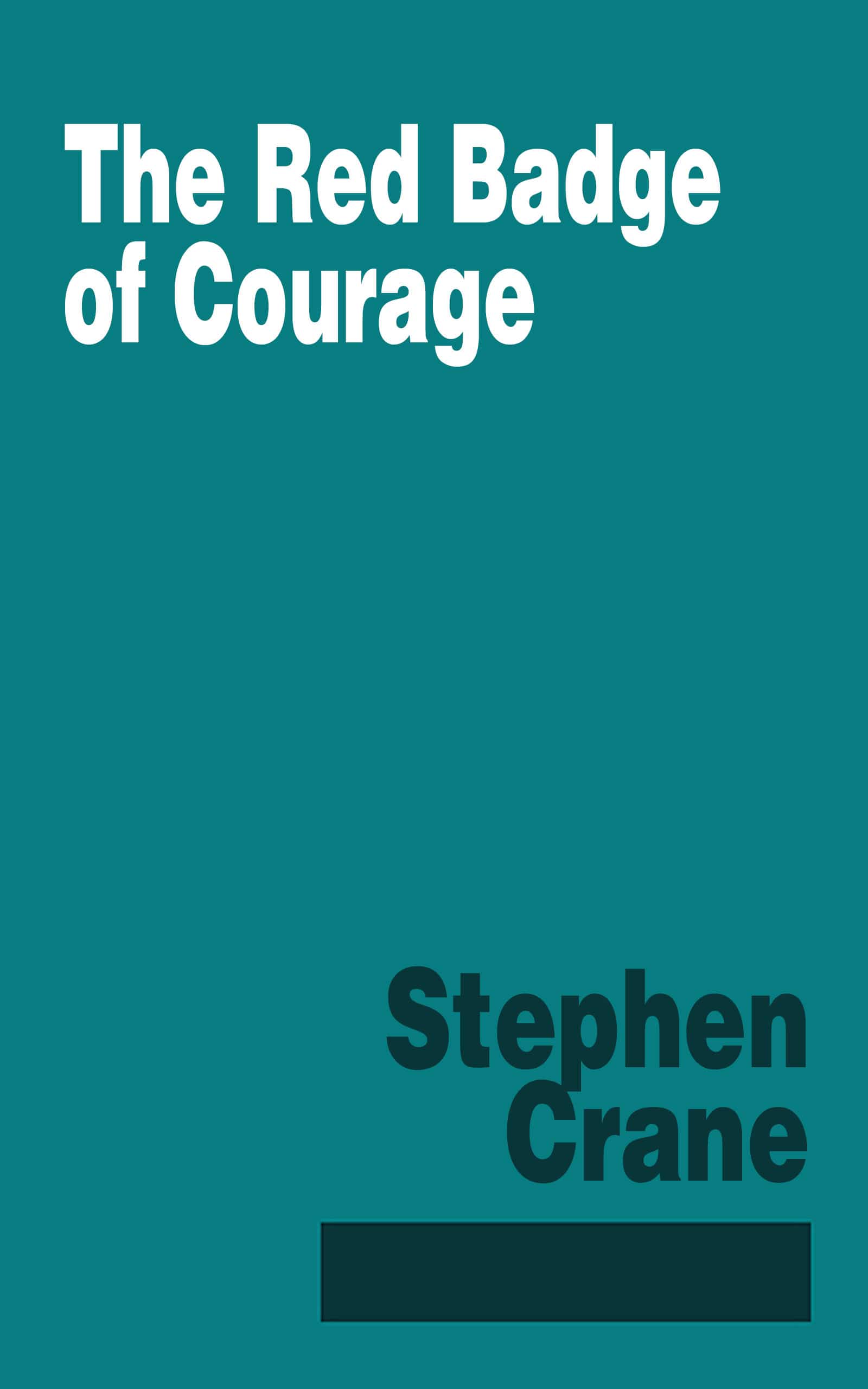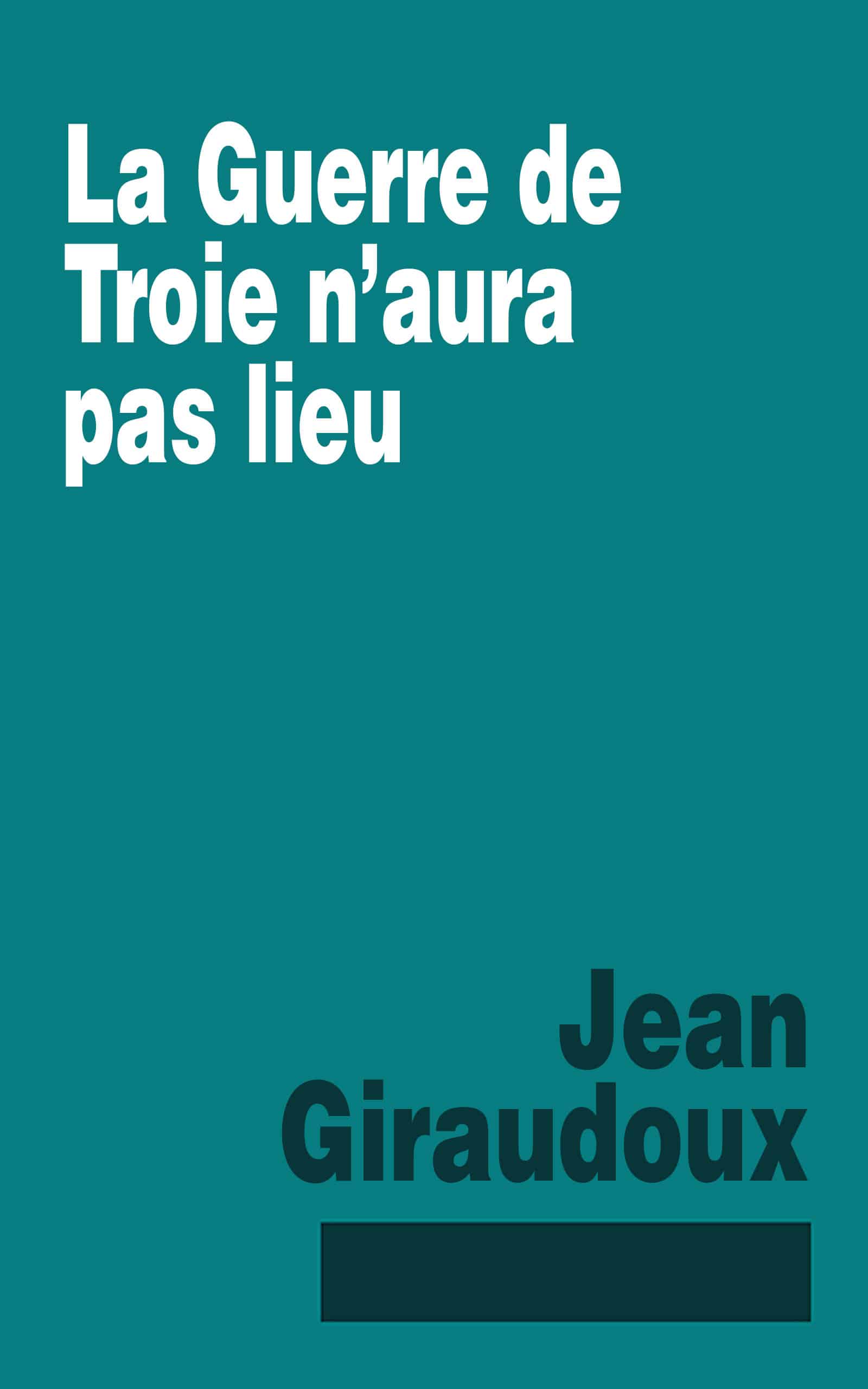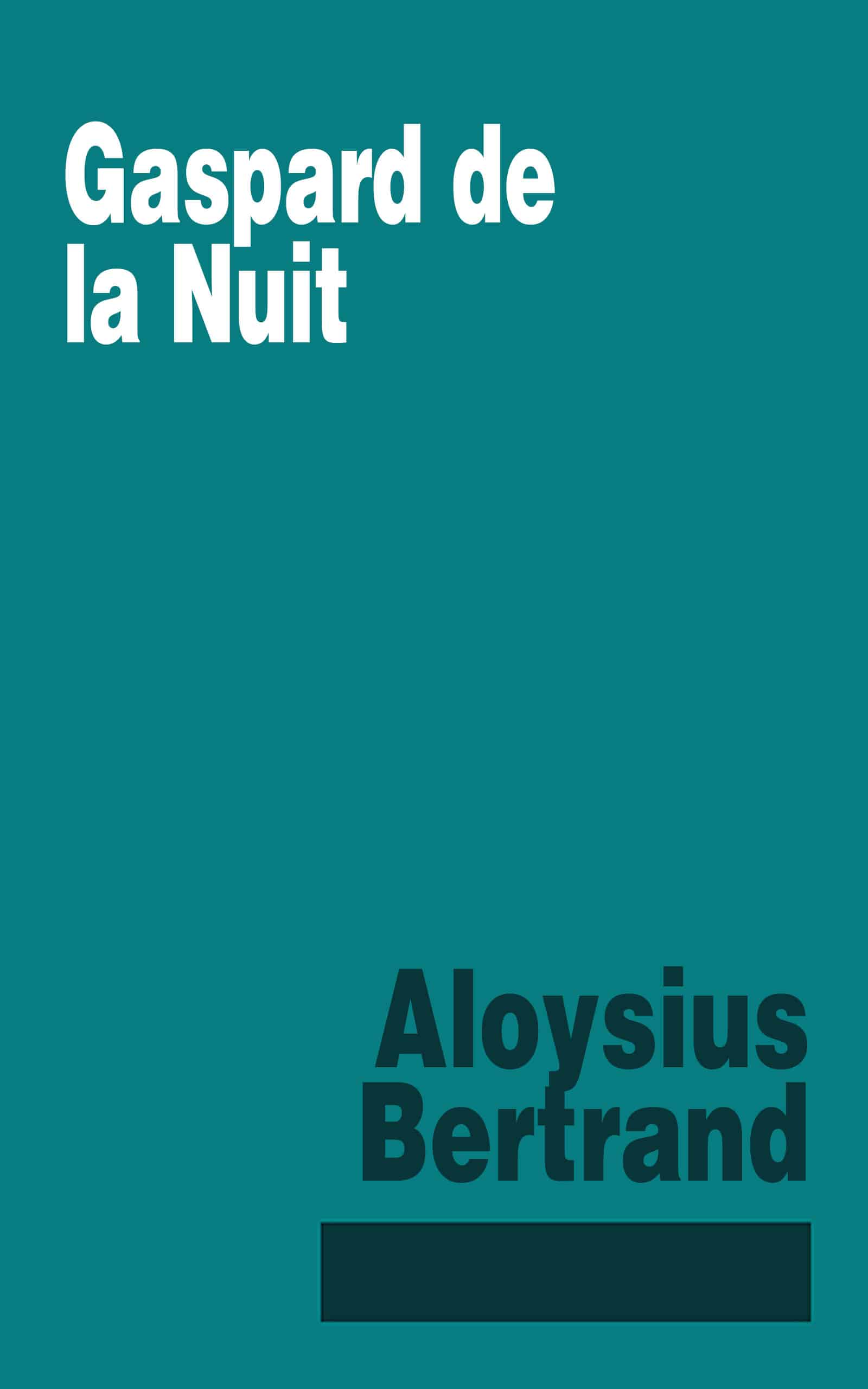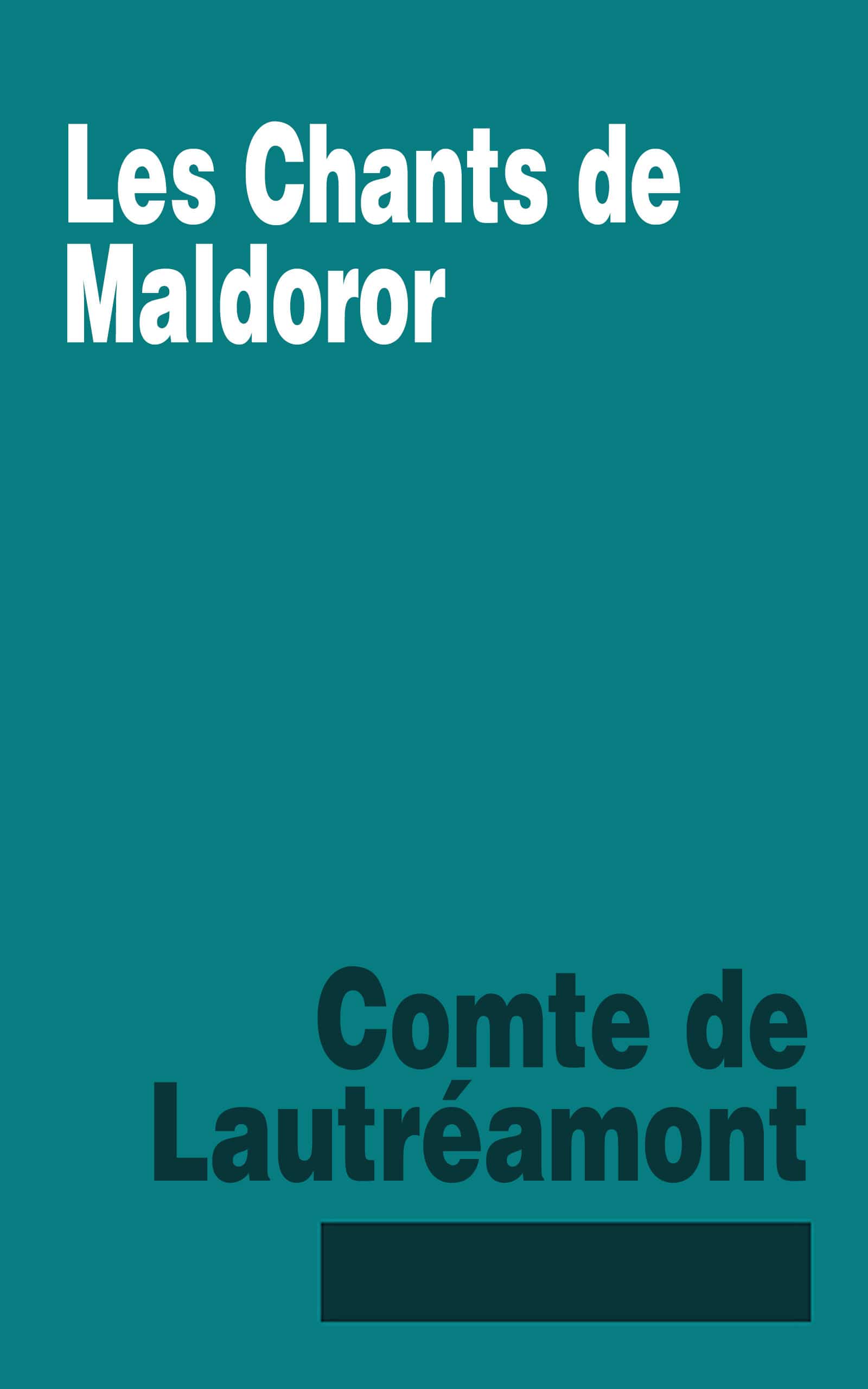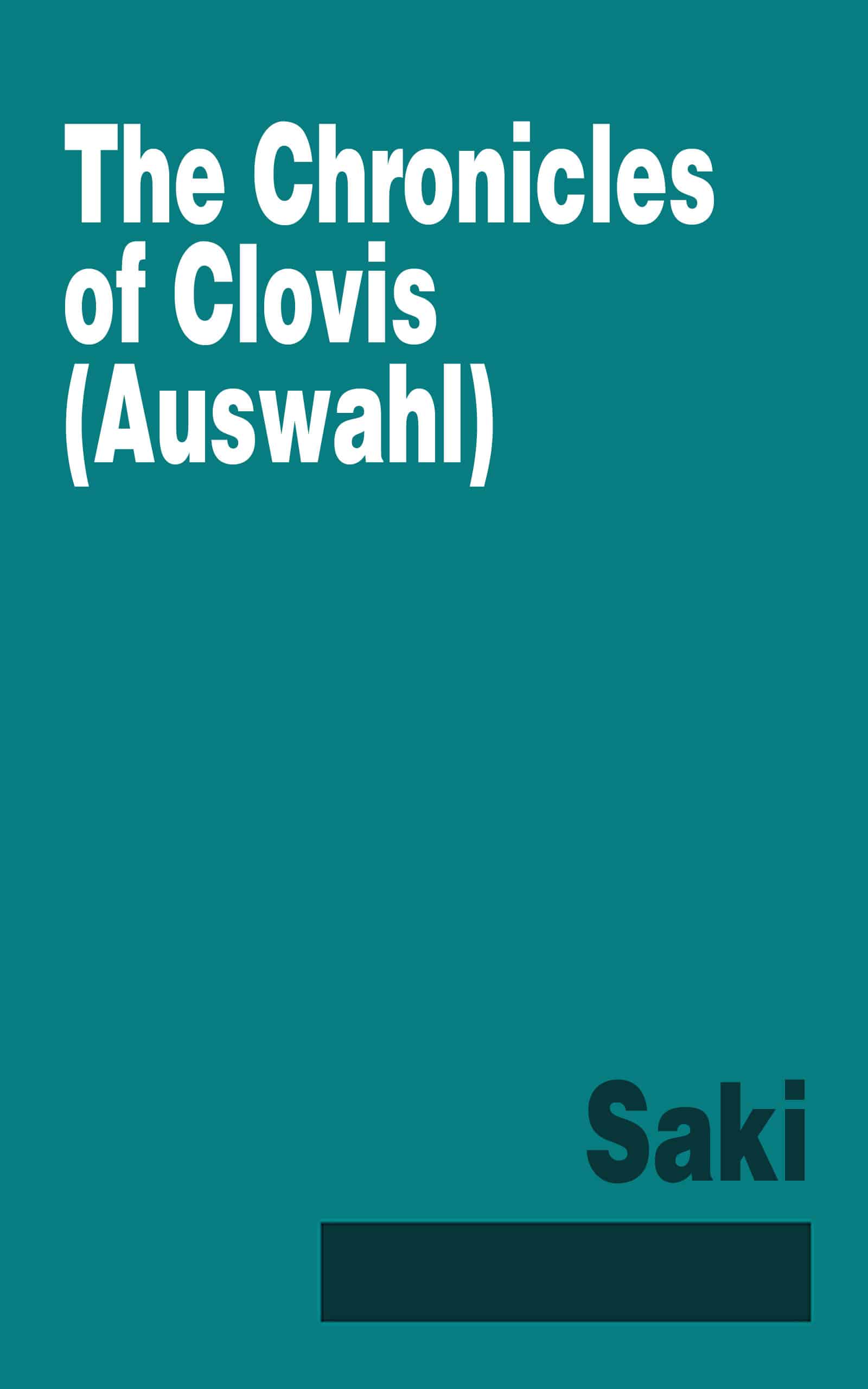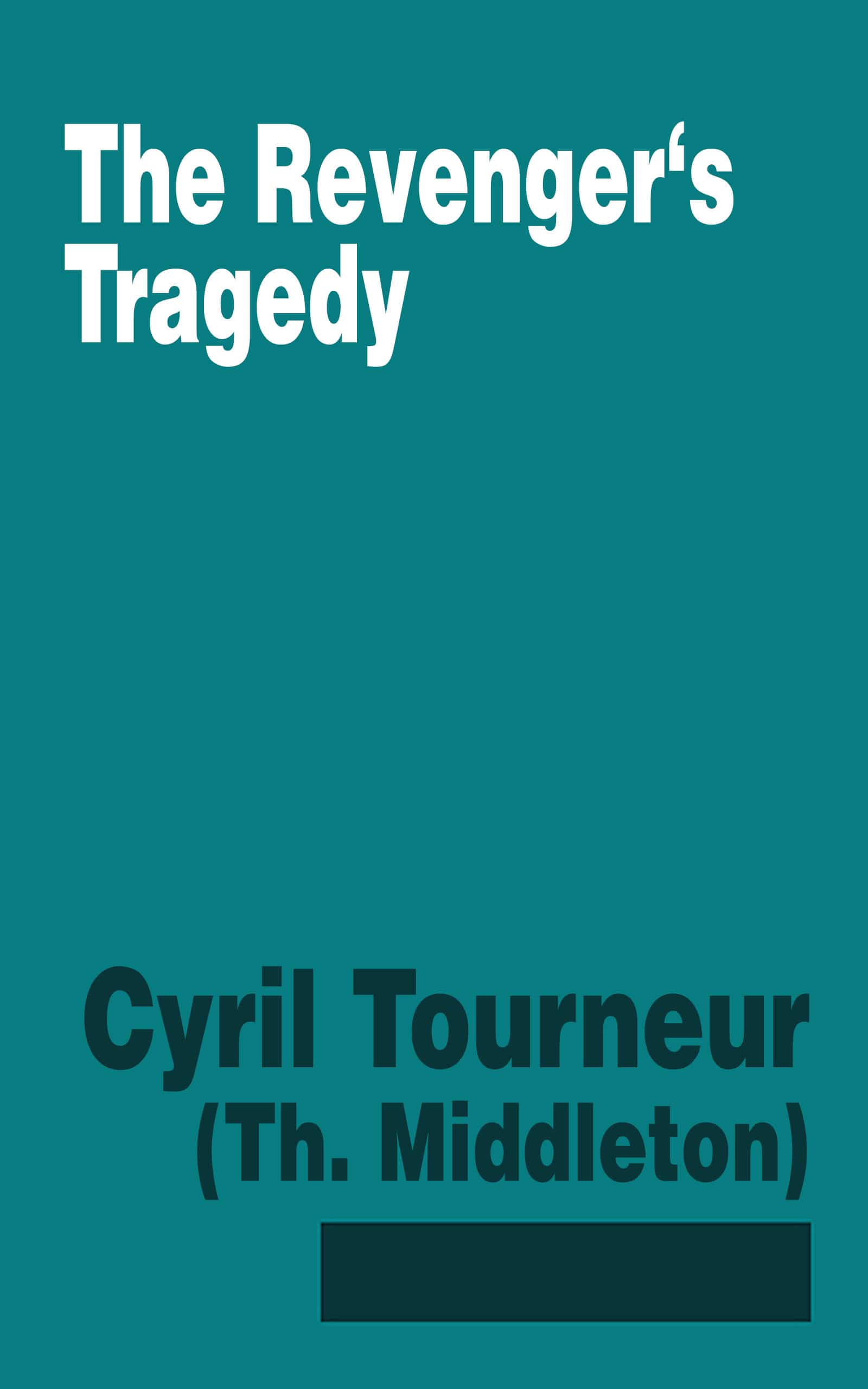Kostenlose E-Books, zur Verfügung gestellt von Martin von Arndt. – Sie haben JavaScript in Ihrem Browser deaktiviert. Um den Inhalt der Tabs anzeigen zu können, brauchen Sie aber ein aktiviertes JavaScript. Wenn Sie nicht wissen, wie dies funktioniert, folgen Sie bitte der Anleitung unter diesem Link.
Kostenlose fremdsprachige E-Books

Kostenlose E-Books: Crane: The Red Badge of Courage + Giraudoux: La Guerre de Troie n’aura pas lieu + Schwob: Vies imaginaires + Bertrand: Gaspard de la Nuit + Lautréamont: Les Chants de Maldoror + Saki: The Chronicles of Clovis + Tourneur: The Revenger’s Tragedy + Hier geht’s zu den deutschsprachigen kostenlosen E-Books + Und hier geht’s zu den kostenlosen wissenschaftlichen E-Books
Literarische Übersetzungen sind eigenständige Kunstwerke – juristisch spricht man davon, dass sie eine „eigene Werkhöhe“ erreichen. Deshalb gilt auch für sie, dass sie erst am 70. Todestag der Übersetzerin / des Übersetzers gemeinfrei werden.
Für einige meiner Lieblingsbücher gilt die Gemeinfreiheit deshalb nur für das Originalwerk, nicht für die Übersetzung. Aber es wäre schade, sie deshalb unter den Tisch fallen zu lassen; zumal der eine oder die andere von Ihnen sie sicher gern im Original lesen würde. Und deshalb präsentiere ich diese Bücher hier ausschließlich in der Ausgangssprache.
Bitte beachten Sie, dass Sie die hier heruntergeladenen E-Books gern weitergeben dürfen an Freund*innen, Verwandte, Bekannte, innerhalb eines Lesekreises. Verkaufen dürfen Sie sie nicht!
Apropos E-Books: Wussten Sie schon, dass ich für Selfpublisher*innen E-Books baue und gestalte? Kontaktieren Sie mich, um ein Angebot einzuholen!